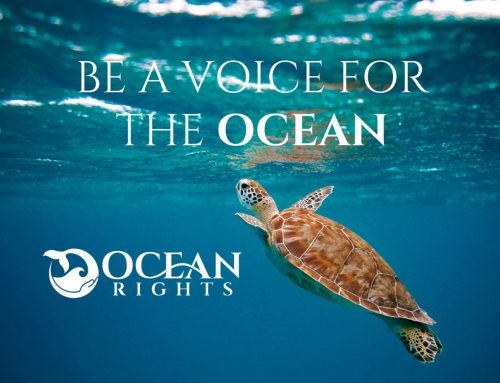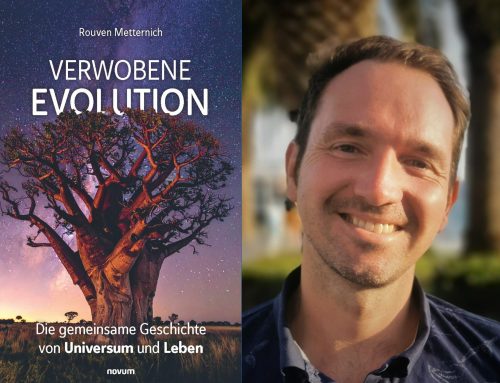Was ist eigentlich Intelligenz? Dies ist nach wie vor eine der großen Fragen im Bereich der Kognitionsforschung. Die Wissenschaft untersucht viele faszinierende Modellorganismen, um der angeführten Frage auf den Grund zu gehen. Doch gibt es eine Tiergruppe, die dabei unter all den anderen deutlich heraussticht – Oktopusse bzw. Kraken und ihre gesamte Verwandtschaft, die Kopffüßer. Die Gründe hierfür sind mindestens genauso vielfältig wie die faszinierenden Eigenschaften dieser Tiere selbst. Nicht genug damit, dass sie acht Arme, drei Herzen und ein Gehirn besitzen, noch verblüffender sind ihre kognitiven Leistungen, die denen aller höheren Wirbeltiere in fast Nichts nachstehen. Und das bei ihrer systematischen Zuordnung – sie gehören zu den Weichtieren (Mollusken). Warum das so besonders ist, hat überaus treffend der Philosoph und Taucher Peter Godfrey-Smith in seinem Buch „Other Minds“ formuliert:
„Kopffüßler – Oktopoden, Kalmare und Nautilusse – sind eine Insel geistiger Komplexität inmitten des Ozeans wirbelloser Tiere.“
Ohne jede Frage gehören gerade Oktopusse, zusammen mit anderen Vertretern der Kopffüßer, zu den intelligentesten Wirbellosen der Welt. Genau genommen ist ein Oktopus so etwas wie ein wandelndes Gehirn, denn das Nervensystem dieser Tiere liegt nicht nur in seinem Kopf, sondern sogar zu zwei Dritteln in ihren Armen. Jeder dieser Arme kann autarke Entscheidungen treffen und verarbeitet den Großteil der aufgenommenen Informationen komplett selbstständig, bis sie dann an das zentrale Nervensystem weitergeleitet werden. Man kann also behaupten, dass es sich hier trotz vieler kognitiver Gemeinsamkeiten mit Säugetieren um eine ganz andere Art von Intelligenz handelt. Hier liegt auch der große Unterschied zu allen anderen hochintelligenten Spezies, denn diese gehören – wie auch wir Menschen – ausnahmslos zum Stamm der Chordatiere. Alle Chordaten teilen einen gemeinsamen evolutionären Ursprung, was damit auch auf ihre Intelligenz zutrifft. Der letzte gemeinsame Vorfahre zwischen Wirbeltieren und Oktopussen vor hunderten Millionen Jahren war ein winziges wurmähnliches Wesen ohne größere kognitive Fähigkeiten. Seitdem hat sich die Intelligenz der zwei Linien völlig unabhängig von der unseren entwickelt.
Manche Studien setzen die kognitiven Fähigkeiten von Oktopussen mit denen von Säugetieren gleich – oder siedeln sie sogar noch höher an. Diese Weichtiere besitzen beispielsweise neben einem differenzierten Kurz- und Langzeitgedächtnis und ausgedehnten Schlafperioden auch die Fähigkeit, verschiedene Individuen anderer Arten zu erkennen und sie auseinander zu halten. So können Oktopusse, die in Gefangenschaft leben, durchaus zwischen verschiedenen Tierpflegern unterscheiden und ihnen ein entsprechendes Verhalten entgegenbringen. Beispielsweise schießen sie einem unliebsamen Menschen gerne mal einen Wasserstrahl direkt ins Gesicht. Eine weitere bemerkenswerte Besonderheit ist ihre Fähigkeit der Abstraktion. So bezeichnet man in der Psychologie die geistige Fähigkeit, den Informationsgehalt eines wie auch immer gearteten Reizes so weit herabzusetzen, dass aus ihm allgemeine Modelle und Vorstellungen entstehen können. Dank dieser Fähigkeit sind wir Menschen beispielsweise in der Lage, einem eher wertlosen Stück Papier wie einem 100-Euro-Schein einen so hohen Wert beizumessen, wie wir es ohne Zweifel tun.
Fast endlos könnten wir weitere Beispiele für die extravaganten Fähigkeiten der Oktopusse aufzählen, doch die Frage bleibt: wie ist all das zu erklären, da wir es doch nach wie vor mit einem Weichtier zu tun haben, dessen nächste Verwandte Schnecken und Muscheln sind? Um der faszinierenden Antwort zumindest etwas näher zu kommen, müssen wir einen Blick auf die winzigen Konstrukteure des Lebens und seiner Leistungen werfen, die Gene. Die neusten Erkenntnisse der modernen Genetik offenbaren Aufregendes über die kognitiven Fähigkeiten dieser außergewöhnlichen Tiere, obwohl große Abschnitte des Oktopus-Genoms im Vergleich zu anderen Weichtieren mehr oder weniger durchschnittlich sind. Sie haben ganz allgemein kein komplexeres Genom oder bedeutend mehr Gene als Schnecken oder Muscheln. Die Unterschiede liegen, wie so häufig in der Biologie, deutlich tiefer verborgen und betreffen vor allem zwei Gruppen von Genen: zum einen jene, die für DNS-bindende Transkriptionsfaktoren kodieren und zum anderen jene für regulative mircoRNS-Moleküle.

Die neusten Erkenntnisse der modernen Genetik offenbaren Aufregendes über die kognitiven Fähigkeiten der Oktopoden.
Zunächst zu den Transkriptionsfaktoren: Dies sind Proteine, welche direkt an die DNS binden und damit andere Gene regulieren können. In der Regel sind es eben diese Proteine, welche allgemein höhere Komplexität erst möglich machen. Bei den Oktopussen ist vor allem eine Gruppe dieser Proteine enorm groß – jene mit einer Zinkfingerdomäne. Sie haben sich gerade im Genom der Oktopusse enorm vervielfältigt. So kommen hier bis zu 1790 proteincodierende Gene mit dieser Domäne vor. Im Vergleich dazu besitzen andere Weichtiere nur durchschnittlich 200 bis 400 solcher Proteine. Selbst der Mensch besitzt nur 764 Gene mit eben dieser DNS-Bindedomäne. Interessanterweise sind beim Oktopus die meisten dieser Gene gerade während der Embryonalentwicklung und in seinem Nervensystem aktiviert. Damit kommen wir also der körperlichen, als auch der kognitiven Komplexität der Kraken deutlich näher.
Einer Erklärung noch näher führt uns die zweite Gruppe der erwähnten Gene. Die sogenannten microRNS-Moleküle sind Gene, welche nie in ein Protein umgewandelt werden, aber trotzdem gezielt die Aktivität anderer Gene regulieren können. Vereinfacht lässt sich sagen, dass Regulation der Schlüssel zur biologischen Komplexität darstellt. Und auch bei diesen Genen stechen die Oktopusse deutlich heraus. Studien, welche die Zusammensetzung der unterschiedlichen microRNS-Moleküle in den Geweben von Oktopussen untersucht haben, kamen erneut zu einem erstaunlichen Ergebnis: Im Nervensystem dieser Tiere fand man über 90 zuvor komplett unbekannte microRNS-Familien. Damit besitzen Oktopusse sogar mehr regulative microRNS-Gene als einige Wirbeltiere.
Diese Tiere besitzen nicht nur eine erstaunliche Anzahl an regulativen Proteinen und mircoRNS-Molekülen, sie sind auch exakt in jenen Organen aktiv, welche die Tiere so besonders machen. Es sagt uns auch etwas über das Wesen biologischer Komplexität: Es geht in aller Regel nicht nur um die schiere Anzahl von Genen, sondern vielmehr um die übergeordnete Regulation. Weitere aktuelle Studien haben vor kurzem gezeigt, dass das regulative genetische Potential dieser Tiere auch dabei hilft, ihre Gehirnfunktionen an unterschiedliche Umgebungstemperaturen anzupassen. Denn nicht alle Oktopusse leben in den Tropen, wo die Wassertemperaturen mehr oder weniger konstant bleiben. Gerade im Mittelmeer können die Temperaturen jahreszeitlich stark schwanken, was die Tiere vor große Herausforderungen stellt. Mittels sogenanntem „editing“ können Oktopusse die Vorläufermoleküle bestimmter Proteine vor allem in ihrem Nervensystem so modifizieren, dass eine optimale neuronale Aktivität erhalten bleibt. Das Faszinierende dabei ist, dass die Kraken dafür keine „anderen“ Gene benötigen. Sie verändern einfach gezielt die vorhandenen Gene so, dass sie bei unterschiedlichen Temperaturen optimal funktionieren.

Oktopus-Intelligenz im Fokus: Ein interdisziplinäres Projekt zur Erforschung des kognitiven Potentials dieser faszinierenden Meeresbewohner. Beim MareMundi Institut Krk soll unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Slany im Zuge des GoDeep Projekts eine künstliche Oktopus Höhle im Meer eingesetzt werden, in der die Meeresbewohner frei leben können. Siehe auch Link unten: Wie intelligent sind Oktopusse? Foto: Wolfgang Slany
Die neuen Erkenntnisse legen nahe, dass gerade die genetische Flexibilität dieser Tiere für ihren Erfolg und ihre mehr als überdurchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten verantwortlich ist. Kraken können wir also – ohne zu übertreiben – als genetische und kognitive Inseln der Komplexität im Reich der Tiere betrachten.
Quellen:
Dr. Rouven Metternich, Panta Rhei – Eine Reise auf dem Fluss der Evolution
Grygoriy Zolotarov et al.; MicroRNAs are deeply linked tot he emergence of the complex octopus brain. ScienceAdvances 2022
siehe auch:
Wie intelligent sind Oktopusse?
Buchempfehlung: Panta Rhei – Eine Reise auf dem Fluss der Evolution
Bericht: Rouven Metternich
Redaktion: Helmut Wipplinger
Fotos: Helmut Wipplinger
Veröffentlicht am 10.07.2023