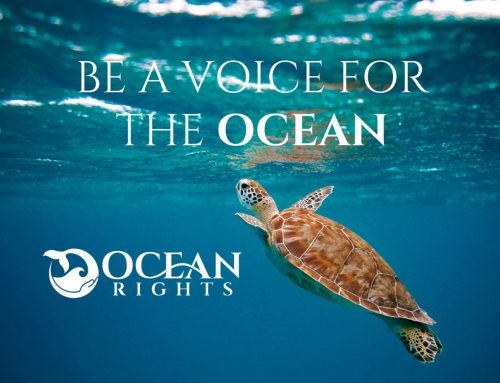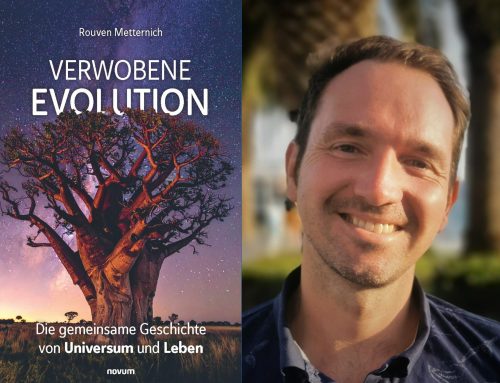Ein Grönlandwal (Balaena mysticetus) schwimmt durch arktische Gewässer
Photo Credit: Vicki Beaver, Alaska Fisheries Science Center, NOAA FIsheries, Marine Mammal Permit#14245
Im Jahre 1845 brach eine groß angelegte Expedition Großbritanniens in die Arktis auf, um mit Hilfe der zwei gut ausgestatteten Schiffe HMS Terror und HMS Erebus die letzten unbekannten 500 Kilometer der sagenumwobenen Nord-West-Passage zu kartieren. Das Kommando über diese überaus wichtige Expedition hatte der bereits sehr erfahrene Polarforscher Sir John Franklin. Doch all seine Erfahrung konnten ihm und seiner Crew nicht vor dem, ihnen bevorstehenden Disaster bewahren. Das schreckliche Ende, das diese Expedition nehmen sollte war vor allem dem unkontrollierbaren und kaum vorhersagbaren arktischen Wetter zu verdanken. Die Schiffe mitsamt ihrer Besatzung sollten vom Packeis in der Nähe von King William Island eingeschlossen und nicht wieder freigegeben werden. Geplagt von Verzweiflung, Hunger und unvorstellbarer Kälte beschlossen die Männer nach vielen Monaten des absoluten Stillstandes den Weg in Richtung Süden zu Fuß zurückzulegen. Doch keiner von Ihnen sollte den 350 Kilometer südlich gelegenen Außenposten in der Hudson-Bay lebend erreichen. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts werden immer wieder die Überreste der über 100 Mann starken Besatzung gefunden, teils sogar mit deutlichen Spuren von Kannibalismus.
Doch noch bevor diese Expedition auf ihr schreckliches Ende zusteuerte, wird Sir John Franklin immer mal wieder einen der faszinierenden Bewohner dieser nichts verzeihenden arktischen Natur begegnet sein. Öfter werden Sie einen weiblichen Grönlandwal (Balaena mysticetus) mitsamt ihrem Kalb gesichtet haben. Zwei gigantische graue Körper, welche die dunkelblaue, spiegelähnliche Oberfläche des arktischen Meeres durchstoßen haben, um tief Luft zu holen.

EIn dunkelgrau-schwarzen Körper mit einigen helleren Narben, die weiße Färbung an der Spitze des Kopfes, die typisch ist für Grönlandwale, ist gut zu erkennen.
Photo Credit: Kate Stafford, Bering Land Bridge National Preserve, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons
Es scheint kaum vorstellbar wie irgendein Säugetier den rauen und geradezu bizarr kalten Gewässern des arktischen Ozeans gewachsen sein soll. Doch hat die Evolution gerade die Grönlandwale mit vielfältigen Spezialisierungen versehen, um in dieser Welt nicht nur überleben, sondern sogar gedeihen zu können. Schließlich sind sie die einzigen Wale, welche das gesamte Jahr über nördlich des Polarkreises verbringen. Sie sind nicht nur extrem groß und mit einem Gewicht von bis zu 100 Tonnen die zweitschwersten Tiere der Welt, sie besitzen alleine eine bis zu 70 cm dicke Fettschicht und einen Schädel, der bis zu einem Drittel der gesamten Körperlänge ausmacht und der es ihnen erlaubt bis zu 30 cm dicke Eisschichten zu durchbrechen. Es wurde sogar vor wenigen Jahren ein gänzlich neues Organ entdeckt, welches nur bei dieser ganz besonderen Walart vorkommt. Dieses sogenannte Corpus cavernosum maxillaris ist ein besonderer Beweis für die ungeheure Anpassungsfähigkeit der Natur, schließlich dient es (glaubt man es oder nicht) den Walen dazu die Organe und vor allem das Gehirn vor Überhitzung zu schützen. Und das in den ganzjährig frostigen Gewässern der Arktis! Denn tatsächlich sind diese Wale fast schon zu gut an diese klirrende Kälte angepasst. Denn auch wenn sie die zweitschwersten Tiere dieser Welt sind, so sind sie dennoch nicht annähernd so lang wie ein Blau- oder Finnwal, ihre Körper werden zwar knapp 18 Meter lang, sind aber eher gedrungen im Vergleich zu dem länglichen Blauwal. Durch diese Körperproportionen verringert sich die Oberfläche (durch welche ja Körperwärme verloren geht) im Verhältnis zum Gewicht dramatisch und durch die Kombination mit der dicken, isolierenden Fettschicht, kann die Körperwärme sogar zu einem Problem werden für ein Tier mit dieser Größe.
Doch eines der herausragendsten Besonderheiten dieser einmaligen Tiere ist ihre schiere Langlebigkeit, denn sie sind die mit Abstand langlebigsten Säugetiere unserer Welt. Sie können laut modernsten Erkenntnissen mehr als 211 Jahre alt werden. Das bedeutet ganze Ären der menschlichen Geschichte liegen eingebettet zwischen der Geburt und dem Tod eines dieser kuriosen Giganten. Tiere die heute noch durch die arktischen Meere schwimmen wurden noch vor dem Zeitalter der Kohle-Industrie geboren, als die Walfangschiffe noch Segel hatten und haben Radionuklide aufgenommen aus der Zeit der großen Atomtests nach dem zweiten Weltkrieg. Und bei einem Tier, das bei dieser Körpergröße so alt werden kann, bedarf es einer Erklärung.
Eine der herausragendsten Besonderheiten ist an dieser Stelle, dass diese gigantischen Tiere trotz ihrer unermesslich hohen Anzahl an Zellen, aus denen ihre Körper sich zusammensetzen, sie nicht wirklich anfällig sind für Krebserkrankungen. Bei Tieren dieser Größe sollten Krebserkrankungen die Lebenserwartung normalerweise drastisch limitieren. Eigentlich sollte die Wahrscheinlichkeit eine Tumorerkrankung zu erleiden mit der Anzahl der Zellen eines Körpers ansteigen, da durch die Anzahl an Körperzellen die Wahrscheinlichkeit für eine maligne Entartung ansteigen sollte, wo doch jede Zellteilung ein gewisses Risiko birgt eine oder mehrere krebserregende Mutationen zu unterlaufen. Eine aktuelle Studie ist diesem lebenserhaltenden Geheimnis der arktischen Giganten einen Schritt nähergekommen. In den meisten Fällen untersuchen die Forscher sogenannte immunologische Checkpoints, welche gewissermaßen evolutionär erworbene Brandmauern gegen die Entstehung und Ausbreitung von bösartigen Tumoren sind. Diese Checkpoints beinhalten beispielsweise ausgewählte Mechanismen des Immunsystems, welche eventuell entartete Zellen erkennen und gezielt abtöten, oder auch sogenannte Tumorsuppressor-Gene.
Doch hinter dem Geheimnis der kälteliebenden Grönlandwale scheint sich (neben diesen etablierten Mechanismen) noch etwas anderes zu verbergen. Über einen ausgeklügelten Mechanismus scheinen diese Tiere dazu in der Lage zu sein, die Stabilität ihres gesamten Genoms effektiver gewährleisten zu können als andere Tiere. Sie nutzen dafür ein Protein namens CIRBP (cold-inducible-RNA-binding-protein), welches auch bei uns Menschen vorkommt und in aller Regel die zellulären Reaktionen auf bestimmte Stressoren wie UV-Strahlung und Kälte reguliert. In den Zellen von Grönlandwalen konnten die Forscher nun extrem hohe Werte für genau dieses Protein nachweisen, während es in den meisten anderen Säugetierzellen nahezu gar nicht nachweisbar war. Da man bereits wusste, dass dieses stress-induzierte Protein unter anderem auch in die Reparatur von genomischer DNS involviert ist, begann sich der Vorhang langsam zu lüften. Um nun jedoch zeigen zu können, dass es wirklich die Wirkung dieses bestimmten Proteins ist, welche für die gesteigerte DNS-Reparatur in den Zellen von Grönlandwalen verantwortlich ist, exprimierten die Forscher eben jenes Wal-Protein durch Zellkultur-Experimente in den Zellen von Menschen. Und siehe da, das übermäßige Vorhandensein dieses Wal-Proteins in menschlichen Zellen bewirkte ebenfalls eine deutlich höhere Rate an erfolgreicher DNS-Reparatur und steigerte damit ebenfalls die Stabilität der menschlichen Zellen.
Um diesen Mechanismus auch noch einmal in einem lebend-Model (in-vivo) zu testen, wurde eben dieses Wal-Protein auch in lebenden Fruchtfliegen (der Art Drosophila melanogaster) künstlich gebildet und wieder hat man einen messbaren und signifikanten Anstieg der Lebenserwartung nachweisen können. Es scheint also tatsächlich so zu sein, dass Grönlandwale ihre unwahrscheinlich lange Lebenserwartung zumindest teilweise einer für Säugetiere seltenen Form der Genom Stabilisierung verdanken.
Und so schwimmen diese arktischen Giganten auch heute noch durch die klirrend kalten Gewässer der nördlichen Halbkugel unseres Planeten. Auch wenn sich ihr Lebensraum heute so stark verändert wie nie zuvor in der Ahnengeschichte dieser beeindruckenden Tiere. So ist es dank der genetisch gesteuerten Lebenserwartung dieser Wale durchaus möglich, dass eines der Wal-Kälber die von Sir John Franklin im Jahre 1845 gesichtet wurden, auch heute noch durch diese Gewässer wandert. Gelenkt durch einen Jahrtausende alten Instinkt, genau durch jene Meereskanäle in denen heute die Überreste der HMS Erebus und HMS Terror auf dem dunklen und kalten Meeresboden ruhen.
Quellen:
Nick Pyenson: Spying on whales
Vera Gorbunova et al. (2025): Evidence for improved DNA repair in long-lived bowhead whale
Bericht: Rouven Metternich
Redaktion: Helmut Wipplinger
Fotos: Vicki Beaver, Kate Stafford
Veröffentlicht am 16. November 2025